Ein Konzept im Rahmen der BMBF-Förderrichtlinie
„T!Raum – TransferRäume für die Zukunft von Regionen“
Bundesanzeiger vom 17.05.2021
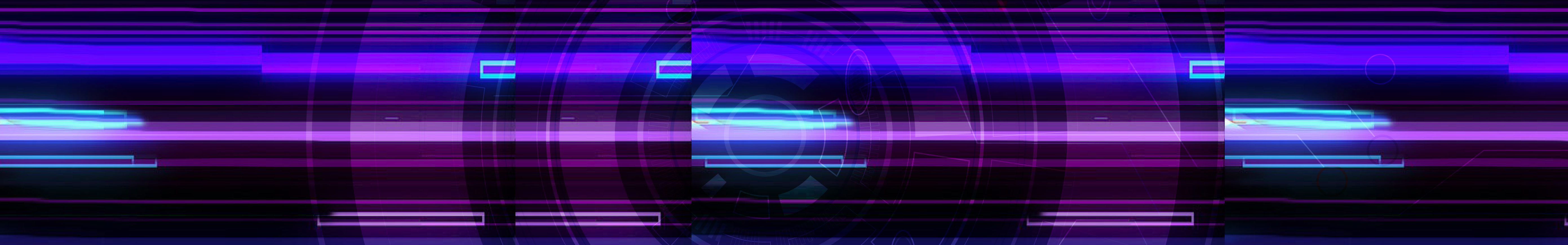
Forschungsprofil
responsive – sustainable – smart
Unsere Themen setzen zur skalierbaren Lösung regionaler, sich aus dem Struktur- und Klimawandel ergebenden Problemstellungen vor Ort an. Die systematische Zusammenführung der herausragenden Kompetenzen, thematischen Schnittmengen und der themenrelevanten Projekte Leipziger Spitzenforscher:innen für den Forschungsbereich „responsive, nachhaltige und smarte Infrastrukturforschung“ über alle Hochschulen und Forschungsinstitute der Stadt hinweg führt zu einem klaren Leipziger Kompetenz- und Forschungsprofil, welches unter den Überschriften Responsive City & Regions, Balancing Ressources und Health & Resilience nach außen hin sichtbar und zugänglich gemacht wird:
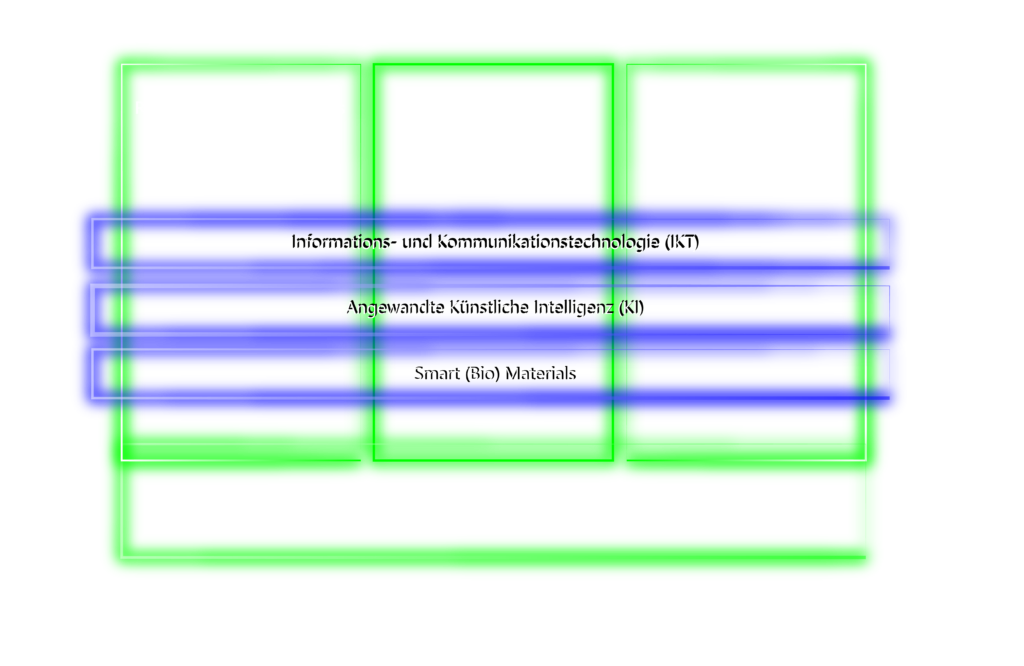
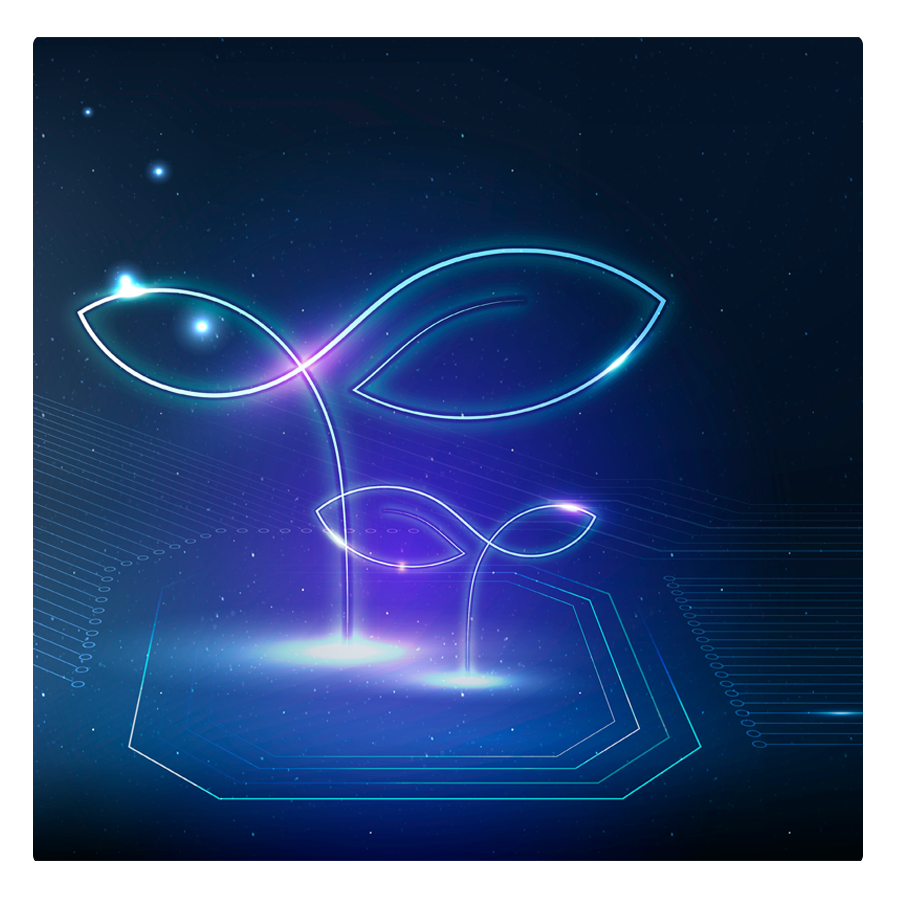
Unter dem Themenbereich Responsive City & Regions subsumieren sich vielfältige Forschungsthemen wie Stadt- und Regionalentwicklung, Smart Living, (klimaneutrale/smarte) urbane Quartiere, Baugrundforschung und Gebäudetechnik, Smart Agriculture, Interoperabilität von Infrastrukturtechnik, Innovationsökonomie und -politik, Partizipation, Infrastrukturökonomik und digitale Bildung.
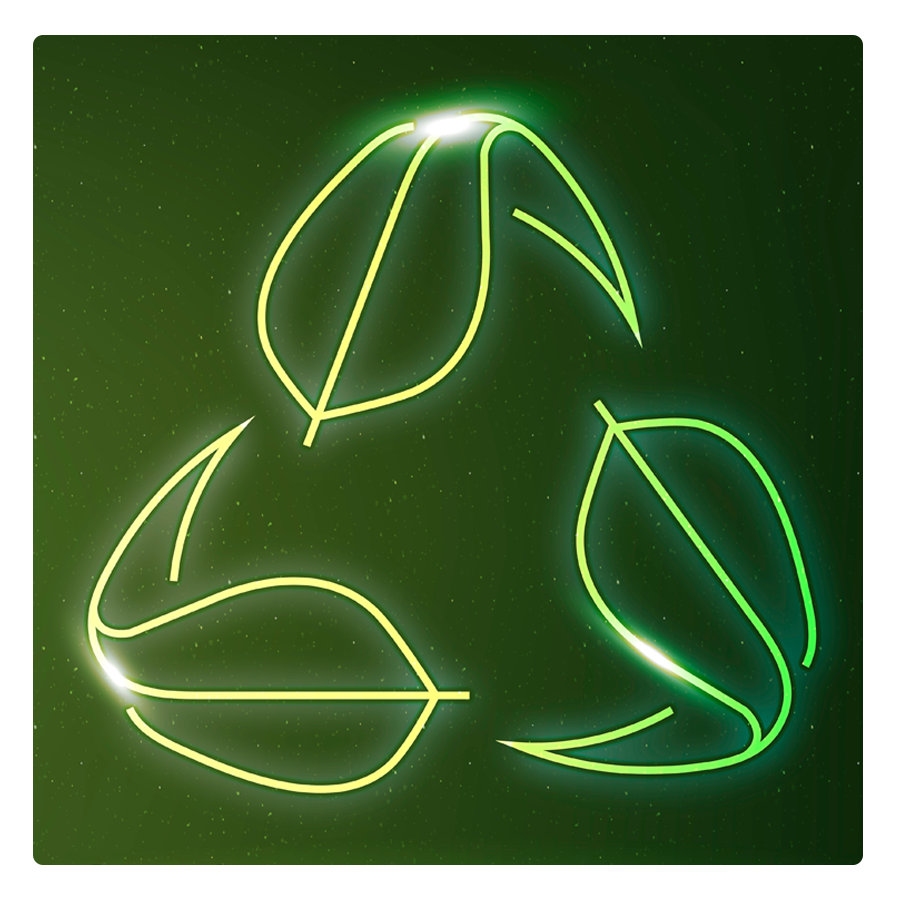
Im Bereich Balancing Ressources – Energy – Water – Space ist die Region Leipzig besonders stark in den Bereichen Energiemärkte und Bioökonomie, energie- und klimapolitische Instrumente, Energie-Systeme (z.B. Smart Grids, Wärmenetze), Prosuming und Sharing von Ressourcen, erneuerbare Energien (insbesondere Biomasse, grüner Wasserstoff, Photovoltaik sowie Wind- und Wasserkraft), Energietechnik, Wasser- und Umweltmanagement und -technik.
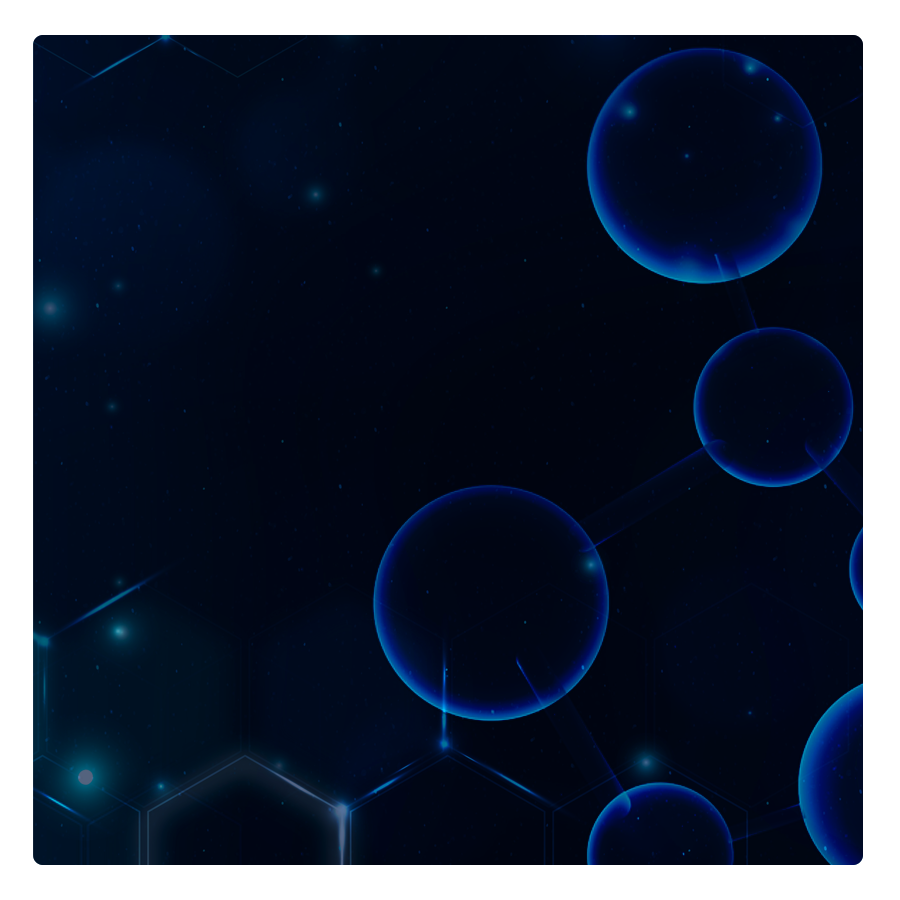
Aus dem Bereich Health & Resilience sind bereits zahlreiche digitale Innovationen im Gesundheitswesen hervorgegangen. Schwerpunkte sind z.B. smarte bioaktive Sensoren, bioelektronische, multiparametrische Analyse-Plattformen für das Monitoring von vitalen Zellen, Geweben, sowie von Biomolekülen, Big Data Analysis, Anwendung von Machine Learning und KI, Prädiktionsmodelle für RisikopatientInnen sowie Entwicklung und Bewertung neuer Technologien und Apps, die sich z.B. auch auf Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit technischer Systeme in anderen Bereichen ausdehnen lassen.
Nachhaltig und smart wird die klassische Infrastrukturforschung durch die Kombination mit unseren technologischen Querschnittsbereichen und der Berücksichtigung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Neuerungen, Trends und Bedarfen aus den Bereichen Recht, Corporate and Innovation Management, Entrepreneurship und der Wirtschaft. Responsiv wird sie durch die Citizen Science Ansätze und die Transfermodule, die ein Ohr an den Problemstellungen der KMU und der Kommunen in der Region haben.
Neben grundlegender Expertise in Informations- und Kommunikationstechnologien liegen die Leipziger IKT/KI-Kompetenzschwerpunkte in den Bereichen maschinelles Lernen, der komplexen Datenverarbeitung und -visualisierung sowie der auf Medizintechnik spezialisierten IKT/KI.
Der Querschnittsbereich smarte biohybride Materialien/Biosensoren liegt sowohl im medizinischen als auch nichtmedizinischen Bereich, z.B. als funktionelle Materialien für Medizinprodukte oder Biosensoren für die Diagnostik oder Monitoring. Biohybride Funktionsmaterialien können als bioaktive Signalgeber und smarte Materialien in unterschiedlichsten Anwendungen wie Signalwandlern, Aktuatoren und Motoren eingesetzt werden. Diese sind praktisch für alle Marktsektoren relevant, insbesondere für die in der Metropolregion Halle, Jena, Leipzig / Sachsen relevanten Wachstumsbranchen der Nanotechnologie, Mikrosystem-, Elektrotechnik und im Life-Science-Bereich.
Durch die thematische Bandbreite der zusammengeführten Forschungsbereiche und Partner sollen unerwartete Synergien der Kompetenzen zu neuen Technologien und kreativen Lösungen führen.